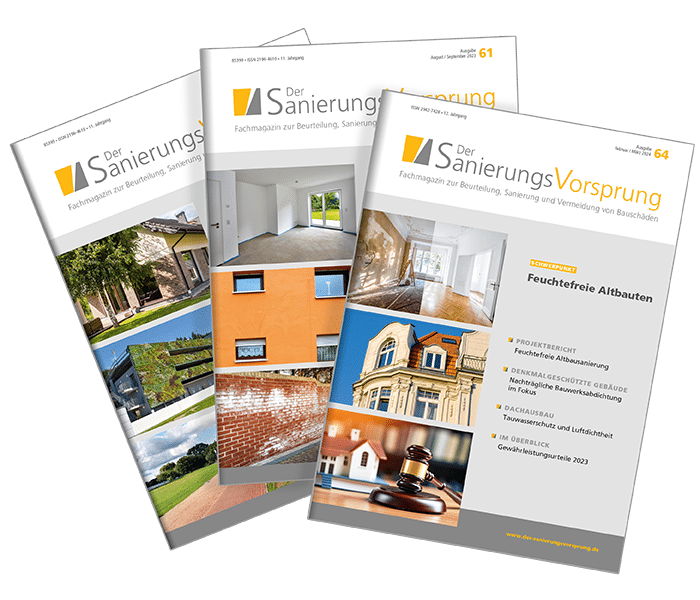Kategorie
Mit Tatortlampe auf Spurensuche
Forensik am Bau mit der UV-gestützten Schimmeldiagnostik
Text: Dipl.-Ing. (FH) Horst Schmid | Foto (Header): © Horst Schmid
Schimmelbefall in Wohngebäuden ist nicht nur ein gesundheitliches Risiko, sondern auch häufig Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen. Besonders problematisch sind verdeckte oder bereits gereinigte Befallsstellen, deren Nachweis erschwert ist. In solchen Fällen kann die Untersuchung mit UV-Licht – umgangssprachlich als „Tatortlampe“ bezeichnet – wertvolle Hinweise liefern. Dieser Beitrag erläutert das physikalische Prinzip der Fluoreszenz, die Anwendungsmöglichkeiten in der Bauschadensdiagnostik sowie die Grenzen der Methode. Anhand eines gerichtlichen Gutachtens wird der kombinierte Einsatz von UV-Licht und mikrobiologischer Analyse vorgestellt. Es zeigt sich: Die UV-Untersuchung ist ein effizientes Werkzeug zur Sichtbarmachung organischer Rückstände, ersetzt jedoch nicht die laborgestützte Befundabsicherung. Nur im Zusammenspiel beider Verfahren lässt sich ein Schimmelbefall forensisch belastbar dokumentieren.
Auszug aus:
Der SanierungsVorsprung
Ausgabe Juni / Juli 2025
Jetzt Leser/-in werden
Schimmelpilze sind natürlicher Bestandteil unserer Umwelt. Sie übernehmen wichtige ökologische Funktionen, werden jedoch in Innenräumen zu einem ernst zu nehmenden hygienischen Problem. Entscheidend für das Schimmelwachstum ist neben einem geeigneten Nährboden vor allem eine dauerhaft erhöhte Feuchtigkeit – entweder durch Bauteildurchfeuchtung oder durch erhöhte Raumluftfeuchte infolge unzureichender Lüftung und Beheizung.
Kritisch wird es vor allem an Wärmebrücken, in Fensterlaibungen, hinter Möbeln oder in schlecht beheizten Räumen.
Bereits eine relative Oberflächenfeuchte von 80 % reicht für viele Schimmelarten aus, um zu wachsen. Wird die Ursache nicht behoben, kann sich der Befall ausbreiten – sichtbar, aber auch unsichtbar. Letzteres erschwert eine sichere Diagnose. Reinigung kann sichtbare Spuren entfernen, lässt aber häufig Rückstände zurück. Genau hier kommt die UV-Analyse zum Einsatz.
Beschreibung des Untersuchungsverfahrens
Die Untersuchung mit UV-Licht basiert auf dem Prinzip der Fluoreszenz: Viele organische Substanzen – darunter bestimmte Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen – absorbieren ultraviolettes Licht und geben es in Form sichtbarer Strahlung wieder ab. Dieser Effekt kann genutzt werden, um Verunreinigungen sichtbar zu machen, die im normalen Tageslicht unsichtbar bleiben.
Die eingesetzten UV-Lampen, umgangssprachlich oft „Tatortlampen“ genannt, stammen ursprünglich aus der kriminaltechnischen Spurensicherung. Dort dienen sie dem Nachweis von Körperflüssigkeiten wie Blut, Speichel oder Urin. In der Bauschadendiagnostik zeigt sich unter UV-Licht typischerweise ein grünlichgelber bis bläulicher Schimmer auf Oberflächen, wenn organische Rückstände vorhanden sind – z. B. von Schimmel, Reinigungsmitteln, Schmutz oder Ablagerungen.
Wichtig ist dabei zu beachten: Die UVMethode kann Hinweise auf einen Befall mit Schimmelpilzsporen liefern, stellt jedoch keinen Nachweis im engeren Sinn dar. Sichtbare Fluoreszenz belegt lediglich das Vorhandensein organischer Substanzen – ob es sich dabei um lebende Pilze, abgestorbene Zellreste oder andere Rückstände handelt, muss durch weiterführende Untersuchungen im Labor geklärt werden. Die UV-Diagnostik ist damit ein ergänzendes Werkzeug zur Ortung verdächtiger Stellen, idealerweise kombiniert mit Materialproben und mikroskopischer Analyse.
Praxisbeispiel: gerichtliches Beweisverfahren
Im Rahmen eines gerichtlichen Beweisverfahrens wurde der Autor vom Landgericht Kaiserslautern beauftragt, die Ursache und das Ausmaß eines behaupteten Schimmelbefalls in einer leerstehenden Eigentumswohnung zu untersuchen. Die Wohnung war bei der Begehung äußerlich weitgehend gereinigt – optisch war kaum Befall sichtbar. Nur an wenigen Stellen zeigten sich noch dunkle Verfärbungen (siehe Abb. 1).
Durch die Untersuchung mit UV-Licht konnten jedoch zahlreiche organische Rückstände aufgespürt werden, insbesondere an Fenstern, Laibungen und Deckenanschlüssen. So zeigte sich z. B. an der Außenecke im Schlafzimmer ein typisches Fluoreszenzmuster – deutlich sichtbar unter UV-Bestrahlung (siehe Abb. 2). Weitere Befunde ergaben sich an den Fensterrahmen der Terrassentür (siehe Abb. 4) sowie an der Außenwand des Wohnzimmers (siehe Abb. 3), wo Schlieren auf frühere, aber unvollständige Reinigungsversuche hinwiesen. Auch am Küchenfenster wurden fluoreszierende Spuren festgestellt (siehe Abb. 5), die unter Normallicht unsichtbar waren.
Diese Beobachtungen belegen, dass ein Schimmelbefall wahrscheinlich vorhanden war, teilweise entfernt wurde, aber organische Rückstände verblieben sind. Die UV-Methode half damit, versteckte und verschleierte Spuren sichtbar zu machen – ein entscheidender Beitrag zur forensischen Beweissicherung.
Absicherung durch Laboruntersuchung
Die durch UV-Licht sichtbar gemachten Rückstände liefern wertvolle Hinweise, müssen jedoch fachlich abgesichert werden. Hierzu wurden im vorliegenden Fall gezielt Materialproben entnommen. An mehreren Stellen in der Wohnung – insbesondere von Tapetenrückseiten sowie Fensterrahmen – wurden Klebefilm-Abklatschproben und Materialproben genommen, die in einem mikrobiologischen Labor untersucht wurden.
Die Laboranalyse bestätigte an einer Tapetenprobe aus dem Schlafzimmer einen eindeutigen Schimmelbefall. In einer weiteren Probe, entnommen von der Außenwand neben der Terrassentür, wurden zwar keine aktiven Kolonien nachgewiesen, aber eine Verunreinigung mit Schimmelsporen festgestellt – ein klassisches Beispiel für sekundäre Verunreinigung durch Sporenmigration aus einem Primärbefall. Eine Folienkontaktprobe vom Fensterrahmen ergab eine dichte Besiedlung mit Schimmelpilzen der Gattung „Cladosporium“, die als typisch für Innenraumbefall gilt. Diese Pilze gelten zwar als vergleichsweise unkritisch, können jedoch in hohen Konzentrationen allergene und reizende Wirkungen entfalten. Für die Bewertung war ausschlaggebend, dass es sich nicht nur um Oberflächenverunreinigungen, sondern um einen aktiven mikrobiellen Befall handelte – ein deutliches Zeichen für unzureichende oder fehlgeschlagene Sanierungsversuche.
Die Kombination aus UV-Befund und Laborergebnis führte im Gutachten zu dem Schluss, dass es in der Wohnung in mehreren Bereichen Schimmelbefall gab und dass dieser durch Reinigung nur oberflächlich behandelt wurde. Eine fachgerechte Sanierung war daher erforderlich.
Ein häufiger Fehler im Umgang mit Schimmelbefall ist die rein oberflächliche Reinigung betroffener Flächen – etwa durch Abwischen mit haushaltsüblichen Mitteln oder alkoholhaltigen Lösungen. Solche Maßnahmen beseitigen sichtbare Spuren, greifen aber nicht in die Materialtiefe ein und entfernen auch keine Sporen aus Ritzen, Fugen oder porösen Untergründen.
Sanierungskonzept
Im hier untersuchten Fall wurde ein fachgerechtes Sanierungskonzept vorgeschlagen, das mehrere aufeinander abgestimmte Schritte umfasst:
1. Rückbau befallener Materialien: Alle Tapeten in der Wohnung sollten vollständig entfernt und entsorgt werden, da auf den Rückseiten Schimmelspuren nachgewiesen wurden.
2. Reinigung mit geeigneten Mitteln: Die Wand-, Decken- und Bodenflächen sowie Fensterrahmen sollten gründlich mit Wasserstoffperoxid behandelt werden. Dieses Mittel hat sich in der Praxis als wirksam zur Reduktion mikrobieller Kontamination erwiesen.
3. Erfolgskontrolle: Nach der Reinigung sind Abklatschproben zu entnehmen und im Labor auszuwerten, um den Erfolg der Maßnahme sicherzustellen.
4. Wiederherstellung der Oberflächen: Nach erfolgreicher Reinigung und Freigabe können die Wandflächen neu tapeziert und gestrichen werden.
Fazit
Die Untersuchung mit UV-Licht stellt ein effektives Hilfsmittel zur Sichtbarmachung organischer Rückstände in Innenräumen dar. In Fällen, in denen Schimmelpilzbefall vermutet, aber nicht oder nicht mehr sichtbar ist, kann die UV-Technik wichtige Hinweise liefern und die gezielte Probenentnahme unterstützen.
Sie ersetzt jedoch keine mikrobiologische Analyse: Nur durch Laboruntersuchungen lässt sich sicher feststellen, ob ein aktiver Befall vorliegt. Die Kombination beider Verfahren – UV-Diagnostik und Laboruntersuchung – bietet Sachverständigen ein leistungsfähiges Instrumentarium zur Beurteilung und Dokumentation von Schimmelschäden.
Gerade in gerichtlichen Auseinandersetzungen, bei denen es auf den Nachweis von verdecktem oder gereinigtem Befall ankommt, kann der Einsatz eine UV-Lampe zur forensischen Spurensucheeinen entscheidenden Beitrag zur Beweissicherung leisten. Die UV-gestützte Schimmeldiagnostik steht exemplarisch für die zunehmende Bedeutung forensischer Methoden im Bauwesen. In Zeiten komplexer Bauabläufe, gestiegener Qualitätsanforderungen und rechtlicher Auseinandersetzungen gewinnen technische Hilfsmittel zur nichtinvasiven Spurensicherung an Relevanz.
Der Einsatz von UV-Licht ermöglicht eine schnelle, kostengünstige und gerichtsfeste Sichtbarmachung von Befallsspuren – insbesondere in leerstehenden oder sanierten Objekten. Zukünftig könnten digitale Bilddokumentationen, KI-gestützte Mustererkennung oder mobile Laboranalytik diesen Ansatz weiterentwickeln. Für Sachverständige bleibt entscheidend: Nur im Zusammenspiel von Erfahrung, Technik und fachlicher Bewertung lassen sich Schäden verlässlich erkennen und belegen.
Literatur
DIN Fachbericht 4108-8 (2010–09): Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 8: Vermeidung von Schimmelwachstum in Wohngebäuden. DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin
Gutachten Nr. 23-049, Architekt Dipl.- Ing. (FH) Horst Schmid, ö.b.u.v. Sachverständiger für Schäden an Gebäuden, 2024
Netzwerk Schimmel e. V. (2022): Richtlinie zum sachgerechten Umgang mit Schimmelpilzschäden in Gebäuden – Erkennen, Bewerten und Instandsetzen. 3. überarb. Fassung, Wiefelstede
Umweltbundesamt (2017): Leitfaden zur Vorbeugung, Erfassung und Sanierung von Schimmelbefall in Gebäuden. [www.umweltbundesamt.de] (https://www.umweltbundesamt.de)
Zur Person
Architekt Dipl.-Ing. (FH) Horst Schmid ist von der IHK Pfalz öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden sowie von der Architektenkammer Rheinland-Pfalz öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken; Ermittlung von Mieten und Pachten.
Zudem ist Herr Schmid von der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen staatlich anerkannter Sachverständiger für Schall- und Wärmeschutz.
Kontakt
Internet: www.sv-schmid.de
E-Mail: schmid@sv-schmid.de